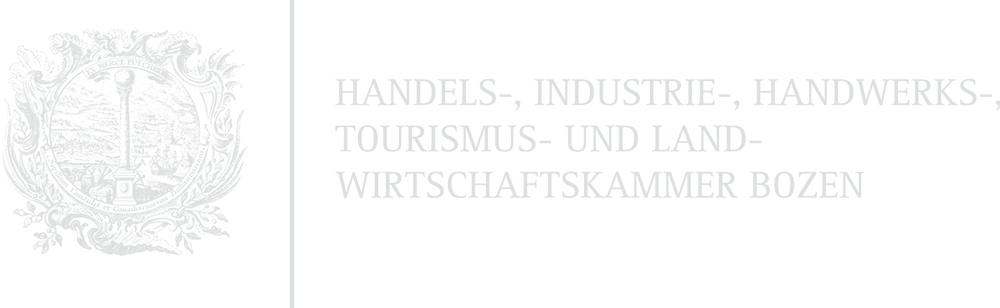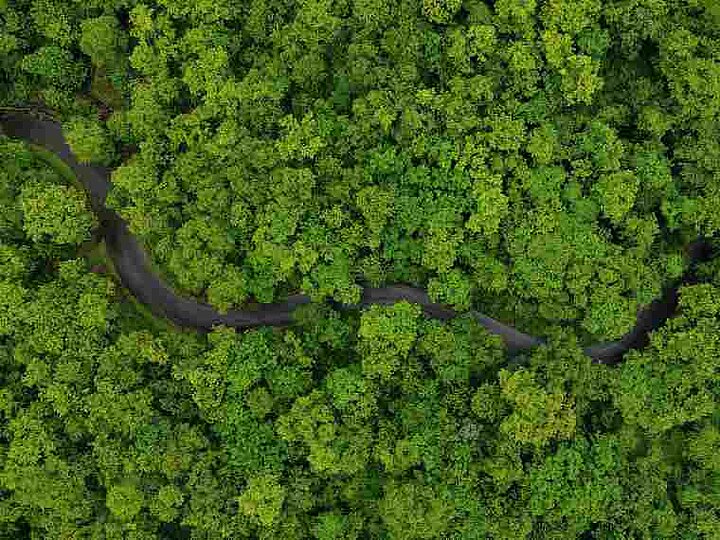
Nachhaltigkeit & duale Transformation in Südtirol
Interview mit Prof. Erwin Rauch, Professor für Nachhaltige Produktion, Freie Universität Bozen
Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind die Innovationstreiber des 21. Jahrhunderts. Wie wirkt sich die duale Transformation auf die Südtiroler Wirtschaft aus?
Die Kombination von Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Betrieb wird sich für Südtirols Wirtschaft als großer Hebel für mehr Wettbewerbsvorteil offenbaren. Die Technologieführerschaft vieler heimischer Unternehmen basiert aktuell noch vielfach auf einem Vorsprung in klassischer Produktgestaltung und Qualität. In den kommenden Jahren wird sich dies sehr stark wandeln. Neben diesen Aspekten wird sich Innovation und Marktvorsprung vor allem durch die Digitalisierung von Produkten, Herstellprozessen oder die Schaffung digitaler Geschäftsmodelle manifestieren. Gleichzeitig strebt die EU mit dem European Green Deal neben Klimaneutralität das Ziel an, in Europa die Führerschaft in sauberen und nachhaltigen Technologien und Dienstleistungen zu übernehmen. Dies stellt für viele bestehende Unternehmen, aber auch für die Start-Up Szene in Südtirol eine große Opportunität dar. Gleichzeitig ist ein Wandel am Finanz- und Käufermarkt zu erkennen. Nachhaltige Unternehmen haben nicht nur Vorteile in der Finanzierung, sondern können ihre Produkte häufig aufgrund eines niedrigeren ökologischen Fußabdrucks einer wachsenden und sensiblen Käuferschicht anbieten.
Seit Jahren forschen Sie an der Schnittstelle zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Wie hängen diese zusammen?
Man könnte sagen, dass Digitalisierung zum einen sicher einen großen Hebel in Richtung Effizienzsteigerung darstellt. Gleichzeitig bildet die Digitalisierung aber auch völlig neue Möglichkeiten zur Gestaltung von nachhaltigeren Wertschöpfungskreisläufen. Unter Nachhaltigkeit verstehen wir das Streben nach einer ausgewogenen, enkeltauglichen Entwicklung, welche ökologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt. Digitalisierung kann uns dabei helfen dieses höher liegende Ziel zu erreichen. So bezeichnet der aus Japan stammende Begriff „Society 5.0“ eine Gesellschaft, welche durch Digitalisierung menschzentrierter und nachhaltiger wird. In Society 5.0 werden Technologien genutzt, um Herausforderungen wie Umweltverschmutzung, demografischer Wandel, Energieeffizienz und gesellschaftliche Ungleichheiten zu meistern. Es wird angestrebt, Technologien so zu gestalten, dass sie das tägliche Leben der Menschen verbessern und gleichzeitig negative Umweltauswirkungen minimieren. Neben den vielen Vorteilen der Digitalisierung müssen wir uns aber auch mit sich negativ auswirkenden Aspekten wie dem steigenden Energieverbrauch durch digitale Technologien auseinandersetzen.
Wie wird ihrer Meinung nach der Megatrend Nachhaltigkeit von den Südtiroler Unternehmen derzeit wahrgenommen?
Mit der Übernahme des neuen Lehrstuhls für Nachhaltige Produktion an der Fakultät für Ingenieurwesen habe ich viele Gespräche mit lokalen Betrieben geführt, um den aktuellen Stand der Unternehmen sowie ihre Bedürfnisse hinsichtlich Nachhaltigkeit besser zu verstehen. Dabei war ich immer wieder überrascht, wie offen und proaktiv die Unternehmen dem Thema gegenüberstehen. Dies ist aus ökologischer Sicht sicher der Naturverbundenheit des Südtirolers der Südtiroler/innen an sich geschuldet und aus sozialer Sicht der Tatsache, dass die lokalen Betriebe häufig Familienbetriebe sind, welche der Ressource Mensch im Betrieb einen hohen Stellenwert einräumen. Die Bereitschaft in nachhaltigere Prozesse und Strukturen zu investieren ist groß. In den üblichen Fällen ist das Thema Chefsache, was auch in der Wahrnehmung seitens der Mitarbeiter/innen wiederum eine enorme Motivation auf allen Unternehmensebenen erzeugt. Natürlich kommt hinzu, dass Nachhaltigkeit bezahlbar sein muss und ein Unternehmen wirtschaftlich nicht schwächen, sondern stärken sollte. Etwas besorgt sehen die Unternehmen allerdings die aktuellen Entwicklungen hinsichtlich Berichterstattung zur Nachhaltigkeit. Der Fokus sollte auf der Umsetzung von Maßnahmen liegen und nicht im „Schmücken“ mit Zertifikaten und seitenstarken Nachhaltigkeitsberichten.